Von Schwachköpfen und Kriegstreibern
Ende November 2020 war die deutsche Öffentlichkeit mit Debatten über Sinn und Unsinn der Corona-Maßnahmen beschäftigt. Von einigen Juristen abgesehen bekam niemand mit, dass dasselbe Konsortium politischer Parteien, die auch die Corona-Maßnahmen einschränkungslos guthießen, im gleichen Zuge auch das Strafrecht änderte. Verschärft wurde die Strafandrohung des § 188 StGB, der Politiker schützen soll: Zuvor waren Politiker lediglich vor übler Nachrede (§ 186 StGB) und Verleumdung (§ 187 StGB) besonders geschützt, seit 2020 sind sie es auch vor einfachen Beleidigungen (§ 185 StGB). Der Unterschied zwischen diesen drei Tatbeständen ist erklärungsbedürftig:
Tatbestand 1: Üble Nachrede
Eine üble Nachrede (§ 186 StGB) setzt eine unwahre Tatsachenbehauptung über einen Menschen voraus, die geeignet ist, ihn verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen.
Beispiel 1: Herr T (wie Täter) behauptet auf einer Vereinsversammlung, die abwesende Frau X sei sicher wieder am Erscheinen gehindert, weil sie bekanntlich jeden Abend auf den Strich geht.
Bestätigt sich diese Äußerung in der Gerichtsverhandlung, ist der Angeklagte schon so gut wie verurteilt. Der Verteidiger kann seinen Mandanten ab dieser Stelle nur noch mit dem sogenannten Wahrheitsbeweis retten. Dazu muss er das Gericht davon überzeugen, dass Frau X tatsächlich als Prostituierte arbeitet, die Aussage seines Mandanten also zumindest im Kern wahr ist.
Tatbestand 2: Verleumdung
Schärfer fällt der Strafrahmen bei der Verleumdung (§ 187 StGB) aus. Auch hier geht es um eine unwahre Tatsachenbehauptung, die geeignet ist, einen anderen Menschen verächtlich zu machen, ihn in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder gar seinen geschäftlichen Kredit zu gefährden. Hinzukommen muss hier allerdings, dass der Täter wider besseren Wissens gehandelt hat.
Beispiel 2: Herr T beliefert Herrn Y seit vielen Jahren mit Ware, die Herr Y stets pünktlich bezahlt. Beide Herren sind sogar miteinander befreundet. Eines Tages nehmen sie an einem Tennisturnier teil. Herr Y gewinnt die Partie mit großem Vorsprung. Aus Gram über die sportliche Niederlage behauptet Herr T eine Woche später auf dem Ball der ehrbaren Kaufleute, Herr Y sei ein „schräger Vogel“, und vor einer Geschäftsbeziehung mit ihm sollte man sich besser hüten, weil dieser seine Rechnungen, wenn überhaupt, erst dann bezahle, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht.
Solche Äußerungen sind geeignet, Herrn Y nicht nur verächtlich zu machen, sondern ihn darüber hinaus an seinem geschäftlichen Fortkommen zu hindern, denn natürlich will niemand ein Geschäft mit jemandem machen, bei dem andere bereits die Erfahrung gemacht haben, dass er anschließend nicht bezahlt. Hier kommt es also nicht allein auf die unwahre Tatsachenbehauptung an, sondern vor allem darauf, dass der Täter bewusst gelogen hat. Weil dies natürlich verwerflicher ist, fällt auch der Strafrahmen entsprechend höher aus.
Tatbestand 3: Beleidigung
Der dritte Straftatbestand der sogenannten Ehrendelikte ist die Beleidigung (§ 185 StGB). Hier kommt es lediglich darauf an, dass der Täter gegenüber einem anderen Menschen seine Missachtung oder Nichtachtung zum Ausdruck bringt. Dass andere Menschen die Äußerung mitbekommen, ist hier nicht erforderlich. Es genügt eine Vier-Augen-Situation.
Beispiel 3: Herr T sagt zu Frau X, sie sei eine fette Sau.
Das genügt. Der Wahrheitsbeweis ist hier nicht vorgesehen: Selbst wenn der Zeugenstuhl unter der Körperfülle von Frau X zusammenbricht und vier Justizwachtmeister es kaum schaffen, sie wieder aufzurichten, lässt sich die Verurteilung wegen Beleidigung allenfalls noch mit einem psychiatrischen Gutachten abwenden, der Angeklagte leide am Tourette-Syndrom und sei deshalb nicht schuldfähig.
Der gesetzliche Strafrahmen des § 185 StGB ist aber mild: Geldstrafe, höchstens ein Jahr Freiheitsstrafe. Der Strafrahmen fällt allerdings größer aus, wenn die Beleidigung vor Publikum stattfindet. Dann drohen sogar zwei Jahre.
Beispiel 4: An der Tafel eines noblen Herrenclubs (man trägt dort Frack) kommt es zu einer ungewöhnlich hitzigen Debatte um grundverschiedene Standpunkte. Der Debattenteilnehmer T schleudert Herrn Y als einem Vertreter des anderen Meinungslagers entgegen: „So, wie Sie aussehen, stellt man sich den typischen Besitzer von Kinderpornos vor.“
Das reichte damals für eine Freiheitsstrafe, die allerdings wegen günstiger Sozialprognose auf Bewährung ausgesetzt wurde. Der Herrenclub schloss übrigens nach dem Vorfall nicht nur Herrn T, sondern auch den Verfasser aus seinem Mitgliederkreis aus, und zwar keineswegs wegen der Übernahme des Verteidigermandats, sondern weil er bei dem großen Ereignis selbst zugegen war und nicht aufhören konnte zu lachen.
Der neu gefasste § 188 StGB
Entgegen neuerdings aufgekommener Ansichten war die Beleidigung eines Politikers schon immer strafbar, denn wie jeden Menschen schützt § 185 StGB auch die Ehre von Politikern. Neu ist lediglich der Strafrahmen: Für die Beleidigung eines Politikers fällt der Strafrahmen durch § 188 Abs. 1 StGB mit drei Jahren Freiheitsstrafe – wohlgemerkt: für eine einfache Beleidigung – größer aus. Dieser Strafrahmen kommt allerdings nur zur Anwendung, wenn
„die Tat geeignet (ist), sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren“.
Was mit dieser Formulierung gemeint ist, ist rätselhaft. Die gängige Gesetzeskommentierung wirkt hilflos und fällt schmal aus. Sie verweist nur auf die Gesetzesbegründung des Bundestags. Die Beleidigung muss hiernach geeignet sein,
„die Glaubwürdigkeit und Lauterkeit des Opfers in Frage zu stellen
oder seine Einflussmöglichkeiten nachhaltig zu schmälern.“
Dies löst das Rätsel nicht, sondern wirft nur neue Rätsel auf.
Praktisches Beispiel:
Wenn jemand beispielsweise die frühere Vorsitzende von Bündnis90/Die Grünen, Frau Lang, wegen ihrer Figur als „fette Sau“ bezeichnet, ist dies zweifellos eine Beleidigung im Sinne des § 185 StGB, nicht anders als bei Frau X im Beispiel 3.
Wenn die Äußerung „fette Sau“ vor dem Publikum sozialer Medien fällt, ist natürlich bereits innerhalb des § 185 StGB der größere Strafrahmen eröffnet, genau wie im Beispiel 4.
Dennoch ist die Äußerung über die Figur von Frau Lang nicht geeignet, ihre Glaubwürdigkeit und Lauterkeit in Frage zu stellen oder ihre Einflussmöglichkeiten nachhaltig zu schmälern, sodass statt § 185 StGB der schärfere § 188 StGB anzuwenden wäre: Auch kräftiger konstituierte Menschen können glaubwürdig und lauter sein. Beides ist keine Frage der Figur.
Eher in Richtung Glaubwürdigkeit und Lauterkeit und somit in Richtung § 188 StGB führen die Äußerung über eine Politikerin der FDP, ihren politischen Forderungen nach sei sie ein „Kriegstreiber“ und „Flintenweib“. Beides ist zwar kein freundliches Wort, aber vom Recht der Meinungsfreiheit umfasst und deshalb ein zulässiges Werturteil. Ihre Kritiker wurden freigesprochen.
Anders wäre es, wenn über jene Dame behauptet würde, sie bastle im Hobbyraum ihres Heimes bereits an einer eigenen Atombombe. Dies könnte ihre Glaubwürdigkeit und Lauterkeit in der Tat in Frage stellen und ihre Einflussmöglichkeiten nachhaltig schmälern. Um solche Tatsachenbehauptungen, die dann schon über die Beleidigung hinaus in die Richtung der üblen Nachrede oder gar der Verleumdung gehen, geht es praktisch aber nie. Die über die Politik empörten Bürgersleute (geschlechtsneutral formuliert) wissen und ahnen vom Leben der von ihnen gescholtenen Politiker schließlich nichts.
Alles in allem darf man sagen, dass § 188 StGB rechtspolitisch verunglückt ist. Seine Relevanz geht gegen Null.
Der „Schwachkopf“-Fall
Nach den vorangegangenen Ausführungen kann nun jeder den viel diskutierten „Schwachkopf“-Fall um Herrn Robert Habeck selbst lösen.
Natürlich ist „Schwachkopf“ kein sachliches Werturteil, sondern eine Beleidigung, allerdings keine, die den Strafrahmen des § 188 StGB eröffnet: Die Glaubwürdigkeit und Lauterkeit kann hierdurch nicht in Frage gestellt werden, denn auch ein Mensch mit schwächerer Auffassungsgabe – das ist mit „Schwachkopf“ wohl gemeint – kann glaubwürdig und lauter sein. Wie die Bezeichnung „Schwachkopf“ die Einflussmöglichkeiten des Politikers nicht nur ein bisschen, sondern ganz nachhaltig schmälern soll, erschließt sich gleichfalls nicht.
Die sich beleidigt fühlenden Politiker wissen dies übrigens selbst. Ginge es wirklich um § 188 StGB, wären ihre vielen Strafanträge nämlich überflüssig: § 188 StGB muss von der Staatsanwaltschaft von Amts wegen verfolgt werden. Bei einer einfachen Beleidigung hingegen findet ein Strafverfahren nur dann statt, wenn der Beleidigte dies ausdrücklich von der Staatsanwaltschaft verlangt. Dadurch erklären sich die massenhaft gestellten Strafanträge, und dies führt zum eigentlichen Problem:
Die Rolle der Justiz
Auf Strafanträge von Politikern reagiert die Justiz anders als sonst:
Wenn Frau X aus obigem Beispielsfall einen Strafantrag stellt, weil sie von Herrn T „fette Sau“ genannt wurde, setzt sich die Justiz eher unwillig in Bewegung. Solche Strafanträge sind mit zusätzlicher Arbeit verbunden, und dabei geht es doch um nichts Weltbewegendes, das man unbedingt ahnden muss. Deshalb wird nur das Nötigste ermittelt und dann vom Schreibtisch aus ein Strafbefehl beantragt. Dieser Strafbefehl ist so dosiert, dass er gute Chancen hat, dass Herr T keinen Einspruch dagegen einlegt. In diesem Fall wird nämlich nicht einmal eine Verhandlung nötig.
Wenn ein Politiker „Schwachkopf“ genannt wird, liegt dies vom Unrechtsgehalt her zweifellos auf gleichem Niveau wie die „fette Sau“. Deshalb müsste auch der Eifer der Justiz auf gleichem Niveau liegen. Um den Täter zu überführen, genügt ein Screenshot der Verlautbarung und die Auskunft von Facebook, um wen es sich bei dem Teilnehmer handelt. Dann würde der Strafbefehl beantragt, und die Angelegenheit wäre erledigt. Gerade weil es das Grundgesetz gebietet, gleiche Sachen gleich zu behandeln und Rechtsfragen ohne Ansehung der Person zu entscheiden, müsste der Strafantrag wegen „Schwachkopf“ genauso behandelt werden wie der Strafantrag der Frau X wegen „fette Sau“. Tatsächlich ist es anders:
Kommt der Strafantrag von einem Politiker, liegt der Ermittlungseifer der Justiz plötzlich merklich höher als im Fall der namenlosen „fetten Sau“ aus der Plattenbauwohnung.
Da läuft es dann so ab:
Hausdurchsuchung als Strafe
Der Staatsanwalt beantragt beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss zum Auffinden von Beweismitteln. Meist winkt der Ermittlungsrichter den Antrag durch, obwohl er nicht nur den konkreten Tatverdacht zu prüfen hat, sondern auch berücksichtigen muss, ob die Durchsuchung im Einzelfall verhältnismäßig ist. Letzteres ist bei einer Beleidigung eigentlich nie der Fall. Dazu aber später.
Mit dem Durchsuchungsbeschluss rückt der Staatsanwalt in Begleitung mehrerer Polizeibeamter meist morgens kurz nach 6 Uhr beim Verdächtigten ein (bis 6 Uhr muss nach § 104 Abs. 3 StPO gewartet werden) und beginnt, dessen Wohnung auf den Kopf zu stellen. Der völlig überraschte Verdächtigte ist zunächst kopflos (und meistens noch im Schlafanzug), sodass es einige Zeit dauert, bis er auf die richtige Frage kommt: Wonach suchen Sie eigentlich? Sobald er den Beamten artig sein Smartphone, sein Tablet und seinen PC ausgehändigt hat, werden diese gleich freundlicher, hören auf, die Wohnung zu verwüsten, stellen eine Quittung über die Geräte aus und nehmen diese mit.
Der Verdächtigte verbringt anschließend den Rest des Tages damit, seine Wohnung aufzuräumen. Seine elektronischen Geräte sieht er viele Monate nicht mehr, und jenes Gerät, von dem aus er „Schwachkopf“ veröffentlicht hat, bekommt er nie mehr zurück, denn es wird eingezogen (§ 74 Abs. 1 StGB). Sofern er Smartphone und PC beruflich benötigt, etwa im Home Office, kann er sich am besten gleich neue kaufen.
Wie das Strafverfahren schließlich ausgeht, ist dann im Grunde einerlei: Die Geldstrafe, die bei einer Beleidigung am Ende fast immer herauskommt, ist für die Betroffenen bei weitem nicht so eindrucksvoll wie das Erlebnis der Hausdurchsuchung und ihre Folgen. Man kann deshalb auf den verwegenen Gedanken kommen, die Staatsmacht wolle ihre Untertanen damit einschüchtern, sodass diese sogar im Fall eines Freispruchs ihre Strafe schon mal weg hätten.
Ein berühmter Strafverteidiger sagte mir einmal, er halte es für richtig, dass jeder Rechtsreferendar während seiner Ausbildung einmal früh um 6 Uhr aus heiterem Himmel die Durchsuchung der eigenen Wohnung erleben muss, um zu verstehen, was für einen massiven Grundrechtseingriff er später als Richter mit dem Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses zulässt. Tatsächlich bleiben bei vielen Betroffenen psychische Schäden zurück, und die meisten wollen dann schnell in eine neue Wohnung umziehen, um das Erlebnis zu verkraften – vorausgesetzt, sie können sich dies leisten.
Auch das Bundesverfassungsgericht mahnte in seinem Beschluss vom 15.12.2023 (1 BvR 52/23) an:
Ein Grundrechtseingriff ist aber jedenfalls dann unverhältnismäßig, wenn naheliegende grundrechtsschonende Ermittlungsmaßnahmen ohne greifbare Gründe unterbleiben oder zurückgestellt werden und die vorgenommene Maßnahme außer Verhältnis zur Stärke des in diesem Verfahrensabschnitt vorliegenden Tatverdachts oder zur Schwere der Straftat steht.
Wenn jemand Schwachkopf genannt wird, wiegt diese Straftat gering, und man muss auch nicht alle elektronischen Geräte des Verdächtigten auslesen, um die Begehung der Tat beweisen zu können. In der zitierten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ging es übrigens ebenfalls um eine Beleidigung, und die Durchsuchung sollte lediglich Beweismittel zu den Einkommensverhältnissen des Beschuldigten, eines Lehrers, zutage fördern. Das Einkommen eines Lehrers lässt sich allerdings auch mit geringerem Aufwand ermitteln: Fragen der Staatsanwaltschaft beantworten beispielsweise das Finanzamt und sogar die Hausbank jederzeit bereitwillig. Da muss man nicht gleich durchsuchen.
Kurz gesagt fällt neuerdings ein gewisser Übereifer der Justiz bei der Ermittlung von Beleidigungsdelikten gegen Politiker auf. Das Vertrauen in den Staat fördert dies sicher nicht, im Gegenteil: Spätestens seit der Corona-Zeit gibt es einen wachsenden Bevölkerungsteil, der glaubt, es würde im Staat nicht mehr alles mit rechten Dingen zugehen. Dazu gehören gerade jene, die sich beleidigend über Politiker äußern. Je härter aber der Staat gegen diese Menschen vorgeht, desto weiter treibt er sie von sich weg statt sie zurückzugewinnen. Damit erweist er sich keinen Gefallen: Aus Beflissenheit gegenüber einzelnen Politikern gibt er seinen eigenen Rückhalt in der Bevölkerung nach und nach auf.
Eine Frage des Formats
Als ich vor vielen Jahren Rechtsanwalt wurde, merkte ich schnell, dass man in diesem Beruf allerhand zu hören bekommt: Prozessgegner rufen einem auf der Straße „hinterfotzige Drecksau“ hinterher, und sobald die Mandanten die Rechnung bekommen, sind sie der Ansicht, ich sei ein „Wucherer“ oder „Halsabschneider“, auch wenn noch so korrekt abgerechnet ist. Trotzdem bin ich nie auf den Gedanken gekommen, einen Strafantrag wegen Beleidigung zu stellen.
Nach meiner Beobachtung gehören bei Beleidigungsdelikten die Täter ganz überwiegend zu jenen Menschen, die ihr Glück im Kleingarten- oder im Kaninchenzüchterverein finden. Aus dieser Ecke kommen dementsprechend auch die meisten Strafanträge. Mich hat dieses Milieu nie angezogen, weil die Fähigkeit, einfach über etwas hinwegzusehen oder gar darüber zu lachen, dort beängstigend schwach ausgeprägt ist. Dies finde ich im Umgang unangenehm.
Genauso unangenehm sind mir Politiker, die Agenturen beschäftigen, um herauszufinden, ob sie gerade jemand irgendwo als Schwachkopf oder sonst was bezeichnet hat. Mir persönlich wäre das herzlich gleich. Nach meiner Auffassung sollten sich Menschen, die sich über derlei Dinge aufregen, im eigenen Interesse besser in den Vorstand eines Kleingarten- oder Kaninchenzüchtervereins wählen lassen, aber nicht in den Bundestag. Dorthin wünscht man sich Köpfe, die über solchen Dingen stehen, aber keine Geister, die das Bedürfnis ausleben, ihren Kritikern mit einer Hausdurchsuchung mal klar zu machen, wo der Hammer hängt. Dem Staat wiederum werden solche Repräsentanten kleineren Formats auf Dauer auch kaum bekommen, denn schon das Sprichwort weiß:
Kommt der Bauer auf Edelmanns Pferd, reitet er’s tot.
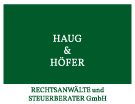
 © Adobe Stock
© Adobe Stock (c) AdobeStock_296763641
(c) AdobeStock_296763641 © Adobe Stock
© Adobe Stock